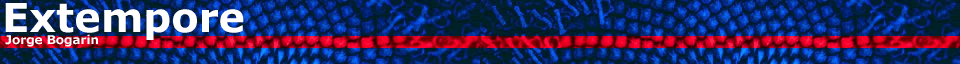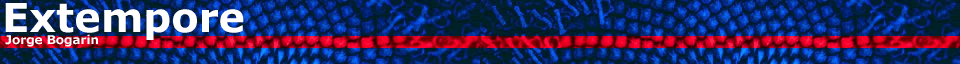|

Zeichen
der Ästhetik: Die Zeichenklasse des ästhetischen Zustands
als zehnstellige Relation
1 Die Große Matrix
Ein wichtiger Teil der Erweiterungen, welche
die Peircesche Semiotik in Stuttgart erfuhr, bestand in der Zuordnung
des rhematisch-indexikalischen Legizeichens durch Max Bense zum
ästhetischen Zustand und zum "Zeichen als solches",
und in der Untersuchung der verschiedenen theoretischen und praktischen
Konsequenzen aus dieser Relation. Der "ästhetische Zustand"
eines Kunstwerkes ist das , was ein Kunstwerk erst zum Kunstwerk
macht, sein Zeichencharakter, seine Zeichenthematik. Eine der speziellen
Eigenschaften dieser Zeichenklasse besteht in ihrer doppelten Symmetrie,
erstens innerhalb der Zeichenklasse (Triade) selbst: 3.1 2 x 2 1.
3 und zweitens in Bezug auf ihre Realitätsthematik: 3.1. 2.2
1.3 x 3.1 2.2 1.3. Max Bense sah diese Symmetrien als mögliche
Begründung für den "ästhetischen Zustand".
Max Bense führte die Große Matrix
ein, um über die kleine Matrix und die zehn Zeichenklassen
hinaus eine präzisere Differenzierung der Zeichen zu erzielen
(Bense 1975). Ausgangspunkt für die Bildung der Großen
Matrix sind die neun Subzeichen, sie werden in einem erweiterten
Schema einmal als Zeile und dann als Spalte notiert. Die Zahl der
innere Produkte steigt dann auf einundachtzig (siehe Anhang 1).
Dieser sehr erfolgversprechende Versuch brachte leider keine nennenswerte
Ergebnisse, die bereits früh erkannten Schwierigkeiten, "...
vor allem bei der Bildung von Zeichenklassen und Realitätsthematiken"
(Walther 1980: 31) wurden nicht überwunden. Einige Aufsätze
über Große Matrix und Ästhetik haben diesen Umstand
nicht berücksichtigt, die Autoren basierten ihre Überlegungen
auf die Struktur der Nebendiagonale dieser Matrix und ignorierten
dabei, dass es keine systematische Methode gibt, welche Zeichenklassen
aus der Großen Matrix bildet und dabei die Nebendiagonale
als eine dieser Klassen festlegt. Nach der Untersuchung dieser Unstimmigkeiten
habe ich in Bogarín 1987 eine Regel vorgeschlagen, um fünfundfünfzig
Zeichenklassen und Realitätsthematiken aus der Großen
Matrix zu generieren. Eine Verallgemeinerung dieses Prinzips auf
eine beliebige Anzahl von Trichotomien findet sich in Bogarín
1991.
2 Peirces 66 Zeichenklassen
Eine andere Möglichkeit, den ästhetischen Zustand über
die Kleine Matrix hinaus zu kategorisieren bietet das aus den zehn
Peirceschen Trichotomien generierte System von 66 Zeichenklassen.
Peirce selbst ließ es nämlich nicht bei den drei Trichotomien
und zehn Zeichenklassen bewenden, sondern versuchte, eine Erweiterung
seiner Klassifikation zu entwickeln. Durch die Einführung von
zwei verschiedenen bezeichneten Objekten (unmittelbaren oder internen
und dynamischen oder externen) und drei bedeutenden Interpretanten
( unmittelbaren, dynamischen und normalen) gelangte Peirce zu den
"zehn Haupttrichotomien der Zeichen" ("The Ten Trichotomies
of Signs", CP 8.345 auch Peirce 1985: 156), oder "zehn
Beziehungen, nach denen die Haupteinteilungen der Zeichen festgelegt
werden" ("ten respects according to which the chief divisions
of signs are determined", CP 8.344 auch Peirce 1985: 155):
1. Gemäß dem Modus der Erfassung des Zeichens selbst
2. Gemäß dem Präsentationsmodus des unmittelbaren
Objekts
3. Gemäß dem Seinsmodus des dynamischen Objekts
4. Gemäß der Relation des Zeichens zu seinem dynamischen
Objekt
5. Gemäß dem Präsentationtsmodus des unmittelbaren
Interpretanten
6. Gemäß dem Seinsmodus des dynamischen Interpretanten
7. Gemäß der Relation des Zeichens zu seinem dynamischen
Interpretanten
8. Gemäß der Natur des normalen Interpretanten
9. Gemäß der Relation des Zeichens zu seinem normalen
Interpretanten
10. Gemäß der triadische Relation des Zeichens zu seinem
dynamischen Objekt und seinem normalen Interpretanten
Tabelle 1: Zehn Haupteinteilungen
der Zeichen
Jede dieser Haupttrichotomien wird wiederum trichotomisch, d.h.
dreifach unterteilt und führen zu einer Matrix aus drei Spalten
und zehn Zeilen (siehe Anhang 2). Aus den dreißig inneren
Produkte werden nach dem "Prinzip der Wohlgeordnetheit"
oder "Forderung der Wohlordnung" insgesamt sechsundsechzig
zehnstellige Zeichenklassen. Die vollständige liste dieser
Zeichenklassen findet sich im Anhang 3.
3 Zeichen der Ästhetik
Der Bensesche Begriff des "ästhetischen Zustands"
wir auf der Ebene der elementaren Zeichenklassen als rhematisch-indexikalisches
Legizeichen charakterisiert. Als Präzisierungen dieses Zeichens
kommen nur erweiterten Zeichenklassen, welche die gleichen Subzeichen
beinhalten. Wir selektieren also aus den 66 Klassen - ich verwende
hier die in CP 8.344 angegebene Anordnung - alle rhematisch-indexikalischen
Legizeichen. Es sind fünfzehn:
12. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-konkretiv-designatives
Legizeichen
13. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-konkretiv-kopulatives
Legizeichen
14. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-kollektiv-kopulatives
Legizeichen
17. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-indexikalisch-konkretiv-designatives
Legizeichen
18. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-indexikalisch-konkretiv-kopulatives
Legizeichen
19. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-indexikalisch-kollektiv-kopulatives
Legizeichen
23. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-indexikalisch-konkretiv-designatives
Legizeichen
24. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-indexikalisch-konkretiv-kopulatives
Legizeichen
25. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-indexikalisch-kollektiv-kopulatives
Legizeichen
30. Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-konkretiv-designatives
Legizeichen
31. Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-konkretiv-kopulatives
Legizeichen
32. Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-kollektiv-kopulatives
Legizeichen
38. Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-konkretiv-designatives
Legizeichen
39. Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-konkretiv-kopulatives
Legizeichen
40. Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-kollektiv-kopulatives
Legizeichen
Tabelle 2: Fünfzehn rhematisch-indexikalische
Zeichenklassen aus 66
Jede dieser zehnstelligen Zeichenklassen kommt als Zeichen des
"ästhetischen Zustands" in Frage. Vielleicht sollten
mehrere der fünfzehn Klassen oder sogar alle als unterschiedliche
Arten von "ästhetischen Zuständen" angenommen
werden.
4 Analyse der zehn Trichotomien
Die Anordnung der Trichotomien in der Zeichenklasse impliziert
eine von links nach rechts absteigende kategoriale Hierarchie. Die
Analyse fängt mit der Trichotomie höchster Semiotizität
an und endet mit dem Mittelbezug.
4.1 Die zehnte Trichotomie: Instinkt,
Erfahrung, Denken
Die Analyse der zehnten Trichotomie, der Relation des Zeichens
zu seinem dynamischen Objekt und seinem normalen Interpretanten,
zeigt, dass das Zeichen des ästhetischen Zustands immer instinktiv
ist, seine Sicherheit entsteht durch Instinkt, nicht durch Erfahrung
oder Denken. Sicherheit durch Instinkt ist die Grundlage der Abduktion,
diese unbegründbare Einsicht in die allgemeinen Elemente der
Natur, die "die allgemeinen Kräfte unserer Vernunft übersteigt
und uns lenkt, als ob wir im Besitz von Tatsachen wären, die
völlig außerhalb der Reichweite unserer Sinne liegen"1
. Wenn wir die Schlussarten der Logik Deduktion, Induktion und Abduktion
mit Sicherheit durch Denken (oder Form), Sicherheit durch Erfahrung
bzw. Sicherheit durch Instinkt charakterisieren, dann hat der ästhetische
Zustand mit Abduktion zu tun, nicht mit Deduktion oder Induktion.
4.2 Die neunte Trichotomie: Rhema,
Dicent, Argumeng
Bei der neunten Trichotomie sind wir auf rhematische
Zeichen festgelegt, wir übernehmen sie aus der kleinen
Zeichenklasse.
4.3 Die achte Trichotomie: saturierend,
praktisch, pragmatisch
Die achte Trichotomie bezieht sich auf die Natur des normalen Interpretanten.
Unsere Tabelle zeigt, daß Zeichenklassen für den ästhetischen
Zustand entweder saturierend oder praktisch sein können. Peirce
spricht auch davon, daß es bei dieser Trichotomie um die Klassifikation
der Zeichen "according to the Purpose of the Eventual Interpretant"
geht, und gibt folgende Möglichkeiten: Genuss erzeugend (Gratific),
Aktion erzeugend (to produce action), Selbstkontrolle erzeugend
(to produce self-control).2
Diese Genuß- oder Gefühlsdimension des Ästhetischen
wurde vor allem in der klassischen Ästhetik betont. Typisch
ist dabei der Begriff der Schönheit, der als Oberbegriff aller
positiven ästhetischen Qualitäten angesehen wird.3
Schönheit ist zunächst ein Phänomen, das sich mit
sinnlichen Eindrücken verbindet. Angenehme sinnliche Empfindungen
bilden die erste Grundlage des Phänomens der Schönheit.
Platon spricht von den "Freuden sinnlicher Wahrnehmung",
die er zu den "reinen Freuden" zählt.4
Für Kant ist ästhetische Erfahrung eine Sache des Gefühls.
Das Gefühl bildet für ihn das dritte "Vermögen
des Gemütes". Was an einer Vorstellung rein subjektiv
ist, nennt er ihre "ästhetische Beschaffenheit".
Als "rein" subjektiv bezeichnet er die gefühlsmäßige
Erlebnisweise, das Gefühl von "Lust oder Unlust",
das wir bei der Vorstellung empfinden. Die Aussage, ein Ding sei
schön, besagt also, daß es -in einer bestimmten Weise-
als lustbringend erlebt wird.5
Max Bense nennt Ästhetiken, die das Kunstwerk unter dem Aspekt
seiner Wirkung auf dem Empfänger, d. h. seiner pragmatischen
Dimension konzipieren, "Saturierungsästhetiken" oder
"Gefallenästhetiken"6.
Diese Art von Ästhetik wurde zwar von der informationstheretischen
bzw. semiotischen Ästhetik erweitert, aber nicht annuliert,
sie ist in ihr enthalten und wurde weitergeführt.
Der ästhetische Zustand als Zeichen erzeugt also Genuß,
oder das ist wenigstens die Absicht des "eventual interpretant".
Ohne den ästhetischen Zustand mit Schönheit zu verwechseln,
bin dafür, die "genuß erzeugenden" Zeichen
für die Ästhetik zu reservieren. Aktion erzeugend wäre
dagegen so etwas wie ein "ethischer Zustand". Die Frage,
inwieweit die moderne Ästhetik jenseits der "Genuß
erzeugenden" auch "praktische" oder "Aktion
erzeugende" Zeichen zu ihrem Untersuchungsbereich macht, ist
dennoch einer Überlegung wert.
4.4 Die siebte Trichotomie: suggestiv,
imperativ, indikativ
Die siebte Trichotomie bezieht sich auf die Relation des Zeichens
zu seinem dynamischen Interpretanten, oder auch: "to the Manner
of Appeal to the Dynamic Interpretant"7.
Hier haben wir zwischen suggestive und imperative Zeichen zu wählen.
Ursprünglich führte Peirce diese als fünfte Trichotomie,
er nannte die Korrelate: "Ejaculative, or merely giving utterance
to feeling; Imperative, including, of course, Interrogatives; Significative".
Später ersetzte er die fünfte Trichotomie durch "Hypothetic,
Categoric und Relative".
Ein suggestives oder ejaculatives Zeichen druckt also Gefühle
aus. Suggestive Zeichen bringen eine Idee durch Assoziation hervor,
sie zeichnen sich aus durch ihre Milde oder Sanftheit (gentleness)8.
Als Folgerungen betrachtet, gehören sie zu den unbewussten
Arten des Schließens.9
Suggestionen finden durch Nähe oder durch Ähnlichkeit
der Ideen statt.10
In der Abduktion - und die zehnte Trichotomie sagt uns, dass wir
hier mit Abduktion zu tun haben - ist die Art der Suggestion, in
der Fakten eine Hypothese suggerieren die Ähnlichkeit, die
Ähnlichkeit der Fakten zu den Folgen der Hypothese.11
Suggestion durch Ähnlichkeit besteht darin, dass zwei Ideen
auf einer natürlichen Art vom Interpreten im Denken verbunden
werden. Ähnlichkeit ist die Tendenz des Interpreten, zwei Ideen
unter einen Begriff zu bringen. Zwei Ideen werden nur innerhalb
der Klasse oder Menge verglichen, zu der sie beiden gehören.12
Suggestive Zeichen sprechen das Gefühl an, nicht den Willen
noch das Denken, und das passt gut zu den saturierenden Zeichen,
die wir aus der achten Trichotomie ausgewählt haben. Eine explizite
Verbindung zwischen suggestiven Zeichen und Ästhetik finden
wir bei Elisabeth Walther:13
Überhaupt scheint die Verpackung,
die 'hübsche Präsentation', die 'geschmackvolle Auslage',
ihre suggestive Wirkung auf den Betrachter selten zu verfehlen.
Ästhetische Momente sind daher überall dort anzutreffen,
wo eine solche Wirkung beabsichtig ist...
Aber auch der Imperative Charakter eines Kunstwerkes wurde von
Bense erwogen:14
Zur pragmatischen Dimension eines Kunstwerkes,
wie eines Zeichens oder eines Komplexes von Zeichen überhaupt,
ist dabei alles zu rechnen, was Verhalten, Handlungen, Gewöhnheiten
auslöst... Ob wir bei der zeichentheoretischen Bestimmung
des ästhetischen Zustands auch imperative Subzeichen der
siebten Trichotomie berücksichtigen sollen, bleibt offen.
4.5 Die sechste Trichotomie: sympathetisch,
schockierend, gewohnt
Die sechste Trichotomie bezieht sich auf dem Seinsmodus des dynamischen
Interpretanten und unterscheidet sympathetische, schockierende,
gewohnte Zeichen, Peirce nennt sie: "Sympathetic, or Congruentive;
Shocking, or Percussive; Usual".15
Es liegt nahe, sympathetische
Zeichen für ästhetische Realitäten zu wählen.
Elisabeth Walther schreibt:16
Die Gefühlsmäßige Reaktion
auf ein Zeichen wird sympathetisch genannt, sie spielt in der
Kunst, besonders in den sogenannten "Befriedigungsästhetiken",
eine große Rolle; nimmt man doch an, ein Kunstwerk wirke
nur dadurch, daß es im Betrachter ähnliche Gefühle
erwecke, wie sie der Künstler zum Ausdruck bringen will.
Peirce macht uns darauf aufmerksam, daß obwohl wir beim ästhetischen
Vergnügen auf die Gesamtheit der Gefühle achten, die sich
im betrachteten Kunstwerk darstellt, dieses enjoyment doch eine
Art intellektueller Sympathie ist, ein Gefühl, das man verstehen
kann, ein vernünftiges Gefühl.17
Das ästhetische Vergnügen ist mit dem Bewußtsein
verbunden, eine Verallgemeinerung zu machen, in der nicht Gefühl,
sondern eher Erkenntnis der hauptsächliche Bestandsteil ist.
Inwieweit dieses "Bewußtsein einer Verallgemeinerung"
mit Kants ästhetischem Begriff der "formalen Zweckmäßigkeit"
verwandt ist, kann ich nur vermuten. Durch diese Überlegungen
unterstreicht jedenfalls Peirce die kognitive Dimension des Ästhetischen,
wie es auch schon Platon, Aristoteles und Kant gemacht haben, aber
wie es vor allem in der modernen Ästhetik eingehend behandelt
wurde.
Der Begriff der Sympathie spielt in der Beschreibung gedanklicher
Prozesse überhaupt eine wichtige Rolle. Peirce unterscheidet
drei Arten der Evolution des Denkens: 1. Evolution durch zufällige
Variation (tychastic development), 2. Evolution auf Grund mechanischer
Notwendigkeit (anancastic development) und 3. Evolution durch schöpferische
Liebe (agapastic development). Die agapastische Entwicklung des
Denkens besteht in der Übernahme gewisser mentaler Tendenzen
aufgrund unmitelbarer Anziehung für die Idee selbst, kraft
der Sympathie (by the power of sympathie).18
4.6 Die fünfte Trichotomie:
hypothetisch, kategorisch, relativ
Bezüglich des Präsentationsmodus des unmmitelbaren Interpretanten
ist ein Zeichen: hypothetisch, kategorisch oder relativ.19
Es geht um den Interpretanten, wie er sich im richtigen Verstehen
des Zeichens selbst enthüllt, und der gewöhnlich die Bedeutung
des Zeichens genannt wird.20
Aus formalen Gründen können wir hier nur zwischen hypothetisch
und kategorisch wählen. Dass die ästhetische Realität
ein hypothetisches Zeichen ist,
wurde in der klassischen und in der modernen Ästhetik oft hervorgehoben.
Max Bense hat diese Eigenschaft "ästhetische Unbestimmheitsrelation"
genannt und als eine der Höchstforderungen definiert, der ein
Objekt zu genügen hat, um ein ästhetischer Gegenstand
zu sein.21
Daß wir hier hypotetische Zeichen wählen wird durch die
Charakterisierung des "ästhetischen Zustands" als
rhematisches Zeichen bekräftigt. Diese enge Verbindung zwischen
wisenschaftlicher Entdeckung, Abduktion und Evolution durch schöpferische
Liebe ist auch ein Argument für die von Max Bense oft betonte
parallele Enwicklung von Wissenschaft und Kunst.
4.7 Die vierte Trichotomie: Icon,
Index, Symbol
Die vierte Trichotomie bestimmt die Relation des Zeichens zu seinem
dynamischen Objekt mit der bekannten Unterteilung: Icon, Index und
Symbol. Aus der dreistelligen Zeichenklasse übernehmen wir
das indexikalische Subzeichen.
4.8 Die dritte Trichotomie: abstraktiv,
konkretiv, kollektiv
Der Seinsmodus des dynamischen Objekts ist:22
a) abstraktiv,
Zeichen von etwas Möglichem, wie Farben, Masse etc.
b) konkretiv, Zeichen von etwas
Wirklichen, wie Karl der Große, Napoleon.
c) kollektiv, Zeichen von Kollektionen,
wie Menschheit usw.
Obwohl sich Peirce gegen die Bezeichnung "abstrakt" für
Empfindungsqualitäten in CP 5.44 noch wehrt, scheint er diesen
Namen doch übernommen zu haben, denn in CP 8.367 sagt er, daß
abstraktive Zeichen Qualizeichen (Mark), und Legizeichen (Type)
kollektive Zeichen sein müssen. Das ist hier relevant, weil
Peirce "das was gegenwärtig ist, so wie es dem Auge des
Künstlers erscheint" und "das Poetische" mit
der Gegenwärtigkeit der Erstheit, mit der Empfindungsqualität
assoziert. Es ist aber klar, dass wir hier aus formalen Gründen
keine abstraktiven Zeichen für unsere Zeichenklasse wählen
dürfen, das heißt, das dynamische Objekt des Ästhetischen
Zustands wird von seiner Relation zum Zeichen selbst determiniert.
Einmal mehr spielt die Zweitheit eine stärkere Rolle und führt
uns durch eine selektive Semiose zum konkretiven Zeichen.
4.9 Die zweite Trichotomie: deskriptiv,
designativ, kopulativ
Diese Trichotomie hat mit dem Präsentationsmodus des unmittelbaren
Objekts zu tun. Peirce beschreibt ihre Komponenten folgendermaßen:23
A. Descriptives,
which determine their Objects by stating the characters of the
latter.
B. Designatives (or Denotatives),
or Indicatives, Denominatives,
which like a Demonstrative pronoun, or a pointing finger, brutely
direct the mental eyeballs of the interpreter to the object in
question, which in this case cannot be given by independent reasoning.
C. Copulants, which neither describe
nor denote their Objects, but merely express the logical relations
of these later to something otherwise referred to. Such, among
linguistic signs, as "If - then - ," "- is - ,"
"- causes - , " "- would be -," "- is
relativ to - for -," "Whatever" etc.
Es ist ersichtlich, das diese Trichotomie sehr eng mit dem Objektbezug
verbunden ist. Deskriptive Zeichen haben ikonischen, designative
indexikalischen und kopulative symbolischen Charakter. Gegen eine
ikonische Sicht des Ästhetischen bringt Bense mit seinem "ästhetischen
Zustand" einen indexikalischen Standpunkt ein, beeinflusst
wahrscheinlich durch die konstruktive bzw. konkrete Kunst. Wir übernehmen
diesen Gedanke und entscheiden uns für die designativen
Zeichen.
4.10 Die erste Trichotomie: Qualizeichen,
Sinzeichen, Legizeichen
Alle fünfzehn erweiterten Zeichenklassen sind Legizeichen.
5 Die vollständige Zeichenklasse
des ästhetischen Zustands
Wenn wir nun die zehn ausgewählten Subzeichen aneinanderreihen
bekommen wir die erste Zeichenklasse aus der Tabelle 1:
12. Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-konkretiv-designatives
Legizeichen
( 10.1 9.1 8.1 7.1 6.1 5.1 4.2 3.2 2.2 1.3 )
In dieser Zeichenklasse ist zu beachten, daß alle Interpretantenbezogene
Subzeichen (10.1 9.1 8.1 7.1 6.1 und 5.1) eine Erstheit, alle objektbezogenen
(4.2 3.2 und 2.2) eine Zweitheit und das Zeichenmittel (1.3) eine
Drittheit als Stellenwert aufweisen. Diese große Zeichenklasse
scheint also eine echte Expansion der Zeichenklasse 3.1 2.2 1.3
zu sein:
Interpretantenbezug
10.1 Relation des Zeichens zu seinem dynamischen Objekt und seinem
normalen Interpretanten: instinktiv
9.1 Relation des Zeichens zu seinem normalen Interpretanten: Rhema
8.1 Relation des Zeichens zu seinem dynamischen Interpretanten:
saturierend
7.1 Normaler Interpretant: suggestiv
6.1 Dynamischer Interpretant: sympathetisch
5.1 Unmittelbarer Interpretant: hypothetisch
Objektbezug
4.2 Relation des Zeichens zu seinem dynamischen Objekt: Index
3.2 Dynamisches Objekt: konkretiv
2.2 Unmittelbares Objekt: designativ
Mittelbezug
1.3 Mittel: Legizeichen
6 Schluß
Einschränkend möchte ich bemerken, dass diese semiotische
Charakterisierung des ästhetischen Zustands als vorläufig
zu betrachten ist, nicht nur was die Bestimmung der einzelnen Korrelate
betrifft, sondern auch wegen der starken Abhängigkeit der Ergebnisse
von der Anordnung der Trichotomien. Diverse Autoren haben darauf
hingewiesen, dass dieses Problem bisher nicht gelöst wurde.24
Wenn wir z. B. die von Irwing Lieb vorgeschlagene Reihenfolge der
Trichotomien nehmen, dann gibt es nur fünf rhematisch-indexikalische
Legizeichen:25
(14) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-kollektives
Zeichen
(19) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-kollektives
Zeichen
(25) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-kollektives
Zeichen
(32) Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-kollektives
Zeichen
(40) Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-kollektives
Zeichen
Tabelle 3: fünf rhematisch-indexikalische
Legizeichen nach Lieb
Unsere Bestimmung der Subzeichen würde auch in diesem Fall
stimmen: hier stehen auschließlich kopulativ-kollektive Zeichen
zur Verfügung, wir können also keine konkretiv-designative
Zeichenklasse wählen.
Unabhängig von dieser unklaren Situation bieten uns Peirces
Haupteinteilungen der Zeichen eine reiche Quelle für semiotische
Untersuchungen. Unter anderem können bereits mit Hilfe der
"kleinen Zeichenklassen" erreichte Ergebnisse durch die
zusätzlichen Trichotomien weiter differenziert werden.
 zum Anfang...
zum Anfang...
Anmerkungen
- CP 5.173, über
Abduktion und Instinkt siehe CP 5.171-5.174
- CP 8.344, 8.373. und Walther
1979: 94.
- Kutschera 1989: 94.
- Philebos, 51a ff. Vgl. Kutschera1989:
95-6.
- Kutschera 1989: 70-1.
- Bense 1982: 10, 340.
- CP 8.371, auch Walther 1979:
95.
- What is ... characteristic
of the phenomenon of suggestion, as the calling up of an idea
through association is called, is its gentleness. CP 7.389
- There is no doubt, therefore,
that ordinary suggestion, regarded as inference, is of the unconscious
variety. CP 8.67.
- the usual doctrine is that
suggestion takes places either by Contiguity or by Resemblance.
CP 7.391.
- The mode of suggestion
by which, in abduction, the facts suggest the hypothesis ist by
resemblance, - the resemblance of the facts to the consequences
of the hypothesis. CP 7.218.
- CP 8.371.
- Walther 1979: 95.
- Bense 1982: 339.
- CP 8.370 und Walther 1979:
93-4.
- Walther 1979: 94.
- CP 5.113 = Peirce 1973:
146.
- CP 6.307, auch Walther
1989: 216.
- CP 8.369.
- CP 5.526. Zitiert nach
der Übersetzung in Rot 44, S. 16.
- Bense 1982: 319, 323-6.
- CP 8.366, Walther 1979:
92.
- CP 8.350.
- S. u. a. Weiss & Burks
1945, Lieb 1953, Sanders 1970, Houser 1990 und Bogarín
1996.
-
S. Lieb
1953. Ich benutze hier "gesetzmäßig" für
Legizeichen.
Anhang 1: Max Benses Große Matrix
|
|
M
|
O
|
I
|
|
1.1
|
1.2
|
1.3
|
2.1
|
2.2
|
2.3
|
3.1
|
3.2
|
3.3
|
|
M
|
1.1
|
1.1 1.1
|
1.1 1.2
|
1.1 1.3
|
1.1 2.1
|
1.1 2.2
|
1.1 2.3
|
1.1 3.1
|
1.1 3.2
|
1.1 3.3
|
|
1.2
|
1.2 1.1
|
1.2 1.2
|
1.2 1.3
|
1.2 2.1
|
1.2 2.2
|
1.2 2.3
|
1.2 3.1
|
1.2 3.2
|
1.2 3.3
|
|
1.3
|
1.3 1.1
|
1.3 1.2
|
1.3 1.3
|
1.3 2.1
|
1.3 2.2
|
1.3 2.3
|
1.3 3.1
|
1.3 3.2
|
1.3 3.3
|
|
O
|
2.1
|
2.1 1.1
|
2.1 1.2
|
2.1 1.3
|
2.1 2.1
|
2.1 2.2
|
2.1 2.3
|
2.1 3.1
|
2.1 3.2
|
2.1 3.3
|
|
2.2
|
2.2 1.1
|
2.2 1.2
|
2.2 1.3
|
2.2 2.1
|
2.2 2.2
|
2.2 2.3
|
2.2 3.1
|
2.2 3.2
|
2.2 3.3
|
|
2.3
|
2.3 1.1
|
2.3 1.2
|
2.3 1.3
|
2.3 2.1
|
2.3 2.2
|
2.3 2.3
|
2.3 3.1
|
2.3 3.2
|
2.3 3.3
|
|
I
|
3.1
|
3.1 1.1
|
3.1 1.2
|
3.1 1.3
|
3.1 2.1
|
3.1 2.2
|
3.1 2.3
|
3.1 3.1
|
3.1 3.2
|
3.1 3.3
|
|
3.2
|
3.2 1.1
|
3.2 1.2
|
3.2 1.3
|
3.2 2.1
|
3.2 2.2
|
3.2 2.3
|
3.2 3.1
|
3.2 3.2
|
3.2 3.3
|
|
3.3
|
3.3 1.1
|
3.3 1.2
|
3.3 1.3
|
3.3 2.1
|
3.3 2.2
|
3.3 2.3
|
3.3 3.1
|
3.3 3.2
|
3.3 3.3
|
 zum Anfang...
zum Anfang...
Anhang 2: Zehn Haupttrichotomien
der Zeichen
Trichotomien Erstheit Zweitheit Drittheit
1. Modus der Erfassung des
Zeichens selbst 1.1 Qualizeichen oder Potizeichen 1.2 Sinzeichen
oder Aktizeichen 1.3 Legizeichen oder Famizeichen
2. Präsentationsmodus des unmittelbaren Objekts 2.1 deskriptiv
2.2 designativ oder
denominativ 2.3 kopulativ
3. Seinsmodus des
dynamischen Objekts 3.1 abstraktiv 3.2 konkretiv 3.3 kollektiv
4. Relation des Zeichens zu seinem dynamischen Objekt 4.1 Icon 4.2
Index 4.3 Symbol
5. Präsentationtsmodus des unmittelbaren Interpretanten 5.1
hypothetisch 5.2 kategorisch 5.3 relativ
6. Seinsmodus des
dynamischen Interpretanten 6.1 sympathetisch 6.2 provokativ oder
schockierend 6.3 konventionell oder gewohnt
7. Relation des Zeichens zu seinem dynamischen Interpretanten 7.1
suggestiv 7.2 imperativ 7.3 indikativ
8. Natur des normalen Interpretanten 8.1 saturierend 8.2 praktisch
8.3 pragmatisch
9. Relation des Zeichens zu seinem normalen Interpretanten 9.1 Rhema
9.2 Dicent 9.3 Argument
10. Relation des Zeichens zu seinem dynamischen Objekt und seinem
normalen Interpretanten 10.1 Sicherheit durch Instink 10.2 Sicherheit
durch Erfahrung 10.3 Sicherheit durch Denken
 zum Anfang...
zum Anfang...
Anhang 3: Peirce's
66 Zeichenklassen
(01) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-qualitativ-deskriptiv-
abstraktives Zeichen
(02) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-qualitativ-deskriptiv-
konkretives Zeichen
(03) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-qualitativ-deskriptiv-
kollektives Zeichen
(04) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-qualitativ-designativ-
konkretives Zeichen
(05) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-qualitativ-designativ-
kollektives Zeichen
(06) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-qualitativ-kopulativ-
kollektives Zeichen
(07) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-singulär-designativ-
konkretives Zeichen
(08) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-singulär-designativ-
kollektives Zeichen
(09) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-singulär-kopulativ-
kollektives Zeichen
(10) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-ikonisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(11) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-singulär-designativ-
konkretives Zeichen
(12) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-singulär-designativ-
kollektives Zeichen
(13) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-singulär-kopulativ-
kollektives Zeichen
(14) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(15) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-hypothetisch-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(16) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
konkretives Zeichen
(17) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
kollektives Zeichen
(18) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-indexikalisch-singulär-kopulativ-
kollektives Zeichen
(19) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(20) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-kategorisch-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(21) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-sympathetisch-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(22) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
konkretives Zeichen
(23) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
kollektives Zeichen
(24) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-kopulativ-
kollektives Zeichen
(25) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(26) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-kategorisch-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(27) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-provokativ-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(28) Instinktiv-rhematisch-saturierend-suggestiv-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(29) Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
konkretives Zeichen
(30) Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
kollektives Zeichen
(31) Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-kopulativ-
kollektives Zeichen
(32) Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(33) Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-kategorisch-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(34) Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-provokativ-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(35) Instinktiv-rhematisch-saturierend-imperativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(36) Instinktiv-rhematisch-saturierend-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(37) Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
konkretives Zeichen
(38) Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
kollektives Zeichen
(39) Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-kopulativ-
kollektives Zeichen
(40) Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(41) Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(42) Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-provokativ-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
Anhang 3: Peirce's 66 Zeichenklassen (Fortsetzung)
(43) Instinktiv-rhematisch-praktisch-imperativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(44) Instinktiv-rhematisch-praktisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(45) Instinktiv-rhematisch-pragmatisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(46) Instinktiv-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
konkretives Zeichen
(47) Instinktiv-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
kollektives Zeichen
(48) Instinktiv-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-kopulativ-
kollektives Zeichen
(49) Instinktiv-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(50) Instinktiv-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(51) Instinktiv-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(52) Instinktiv-dicentisch-praktisch-imperativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(53) Instinktiv-dicentisch-praktisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(54) Instinktiv-dicentisch-pragmatisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(55) Instinktiv-argumentisch-pragmatisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(56) Empirisch-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
konkretives Zeichen
(57) Empirisch-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-designativ-
kollektives Zeichen
(58) Empirisch-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-singulär-kopulativ-
kollektives Zeichen
(59) Empirisch-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-indexikalisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(60) Empirisch-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-kategorisch-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(61) Empirisch-dicentisch-praktisch-imperativ-provokativ-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(62) Empirisch-dicentisch-praktisch-imperativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(63) Empirisch-dicentisch-praktisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(64) Empirisch-dicentisch-pragmatisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(65) Empirisch-argumentisch-pragmatisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
(66) Formal-argumentisch-pragmatisch-indikativ-konventionell-relativ-symbolisch-gesetzmäßig-kopulativ-
kollektives Zeichen
 zum Anfang...
zum Anfang...
|